Was wir aus der Causa Brosius-Gersdorf über politische Kommunikation lernen können
Wer öffentlich spricht, überzeugt nicht nur mit Argumenten – sondern mit Haltung. In der aktuellen Debatte um Frauke Brosius-Gersdorf zeigt sich exemplarisch, wie politische Rhetorik auf Glaubwürdigkeit, Kontext und Konflikt angewiesen ist – und was passiert, wenn Haltung als Angriff missverstanden wird.
Rhetorik ist mehr als Technik: Sie ist eine Haltung
In der klassischen Rhetorik unterscheidet Aristoteles drei Grundpfeiler wirksamer Rede:
- Logos – die sachliche Argumentation,
- Pathos – der emotionale Zugang,
- Ethos – die Glaubwürdigkeit des Sprechenden.
Heute, im Zeitalter hochkomplexer politischer Debatten, wird das Ethos zur entscheidenden Ressource. Menschen fragen nicht nur: „Was wird gesagt?“
Sondern: „Wer spricht da – und warum?“
Die Debatte rund um die Nominierung der Verfassungsjuristin Frauke Brosius-Gersdorf zeigt, wie tief politische Rhetorik mit Fragen der persönlichen Integrität, wissenschaftlicher Einordnung und öffentlicher Lesbarkeit verwoben ist.
Der Fall Brosius-Gersdorf: Ein Konflikt um Deutungshoheit
Brosius-Gersdorf wurde im Juli 2025 von der SPD als Richterin am Bundesverfassungsgericht nominiert. Fachlich unumstritten, juristisch renommiert, wissenschaftlich profilierter Hintergrund.
Trotzdem wurde ihre Wahl kurzfristig auf Eis gelegt – mit dem Verweis auf angeblich „umstrittene Positionen“ zum Thema Abtreibung.
Doch was hatte sie wirklich gesagt?
- Sie argumentierte, dass eine liberalere Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im ersten Trimester verfassungskonform möglich sei – unter der Bedingung staatlicher Schutzmaßnahmen.
- Sie hinterfragte dogmatisch überlieferte Grundsätze zur Menschenwürde des Embryos, ohne sie aufzugeben.
- Sie legte ihre Argumente offen, nicht als politische Positionierung, sondern als juristisch fundierte Analyse.
Was folgte, war keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern eine rhetorische Rahmung: Brosius-Gersdorf wurde zur Symbolfigur einer angeblichen Entgrenzung – obwohl sie in Wirklichkeit für Differenzierung und verfassungstreue Reformfähigkeit steht.
Politische Kommunikation: Wer spricht, ist oft wichtiger als was gesagt wird
Die Rhetorik der Debatte verlief nicht entlang juristischer Argumente – sondern entlang moralischer Zuschreibungen. Brosius-Gersdorf wurde in Teilen der politischen und medialen Öffentlichkeit nicht als Expertin gehört, sondern als politisches Signal gelesen.
Das ist ein typischer Vorgang in politischer Rhetorik:
Es zählt nicht nur die Aussage, sondern der Ort, von dem aus gesprochen wird – und wie dieser rhetorisch gedeutet wird.
Die Kommunikationsstrategie ihrer Gegner:innen war klar:
- Statt auf ihre Argumente einzugehen, wurde ihr Ethos angegriffen.
- Ihre Aussagen wurden entkontextualisiert, zum Teil verzerrt oder radikalisiert dargestellt (z. B. durch die Behauptung, sie wolle Abbrüche „bis zur Geburt“ legalisieren – was sie explizit ablehnte).
- Es wurde eine moralische Polarisierung erzeugt: Wer für sie ist, sei gegen den Lebensschutz.
So wurde aus einer differenzierten Juristin rhetorisch eine angeblich „extreme“ Figur.
Haltung als rhetorische Autorität – nicht Trotz, sondern Transparenz
Was Brosius-Gersdorf in dieser Situation auszeichnete, war Haltung – verstanden als rhetorische Klarheit:
- Sie sprach nicht taktisch, sondern aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive heraus.
- Sie begründete ihre Position offen – mit juristischen Quellen, dogmatischer Logik und fachlicher Konsistenz.
- Sie wies Angriffe zurück, ohne sich auf das Niveau ihrer Gegner zu begeben.
In der Rhetorik nennt man das authentisches Ethos: eine Form der Glaubwürdigkeit, die nicht durch Konsens, sondern durch redliche Selbstverortung entsteht.
Diese Art von Haltung wirkt – nicht, weil sie laut ist, sondern weil sie durchdacht, transparent und risikobereit ist.
Wissenschaft und Objektivität? Die Illusion neutraler Kommunikation
Ein weiterer Aspekt dieser Debatte betrifft die erwartete Neutralität von Wissenschaftler:innen. Gerade in der politischen Kommunikation herrscht oft die Illusion: Wer wissenschaftlich arbeitet, müsse „objektiv“ und „unparteiisch“ sein – also ohne Perspektive, ohne Haltung.
Doch die Wissenschaftsphilosophie ist längst weiter:
- Thomas Kuhn zeigte: Jede wissenschaftliche Erkenntnis ist theorieabhängig – sie hängt vom Paradigma ab, in dem geforscht wird.
- Donna Haraway spricht von „situierter Erkenntnis“: Wissen entsteht nie aus dem Nirgendwo, sondern ist verortet – sozial, historisch, biografisch.
Wenn also eine Verfassungsrechtlerin eine liberale Position zur Abtreibung entwickelt, ist das keine ideologische Entgleisung, sondern eine legitime argumentative Positionierung – solange sie transparent ihre Gründe dafür darlegt.
Genau das ist passiert.
Was wir aus der Debatte lernen: Rhetorik braucht Haltung
Die politische Kommunikation rund um Brosius-Gersdorf zeigt, wie zentral Haltung für überzeugende, faire und demokratisch tragfähige Rhetorik ist:
- Ohne Haltung verkommt Sprache zur Strategie.
- Ohne Ethos werden Argumente nicht gehört.
- Ohne Differenzierung wird die Öffentlichkeit zur Bühne des Verdachts.
Rhetorik ist keine Technik zur Überredung.
Sie ist – im besten Fall – eine Praxis der Selbstverantwortung im Sprechen.
Fazit: Wir brauchen eine Rhetorik der Integrität
Der Umgang mit Frauke Brosius-Gersdorf zeigt:
Wir brauchen in der politischen Rhetorik weniger moralischen Alarmismus – und mehr rhetorische Aufrichtigkeit.
Haltung bedeutet nicht Rechthaberei.
Sondern die Bereitschaft, für etwas einzustehen, ohne andere mundtot machen zu wollen.
Das ist das Gegenteil von Ideologie – es ist öffentliche Selbstverantwortung.
Denn wer öffentlich spricht, steht nicht nur für Inhalte –
sondern für die Art und Weise, wie wir streiten.






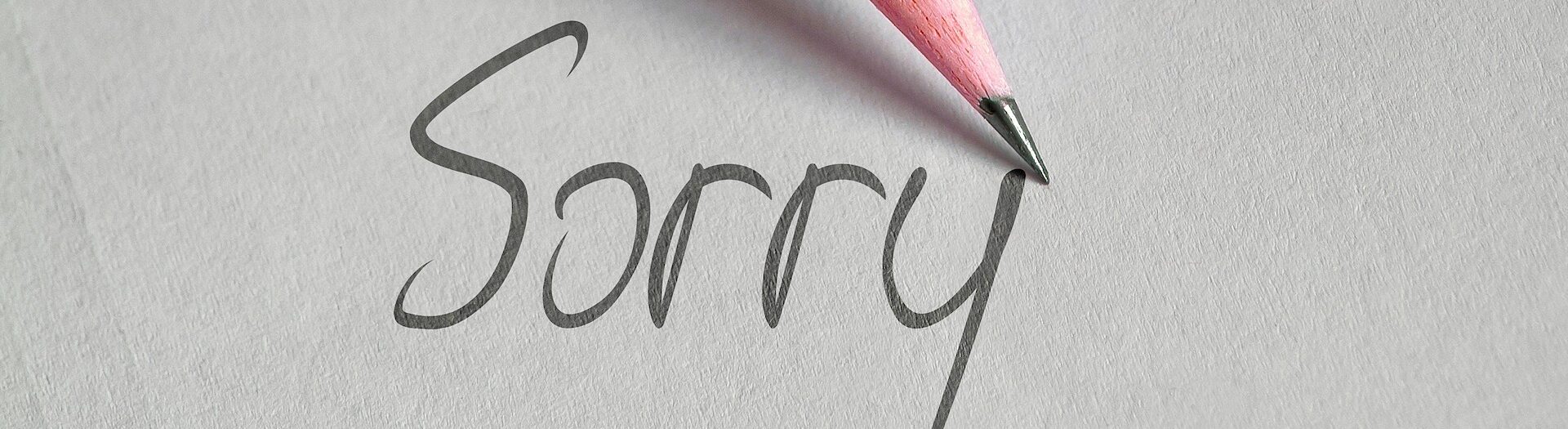
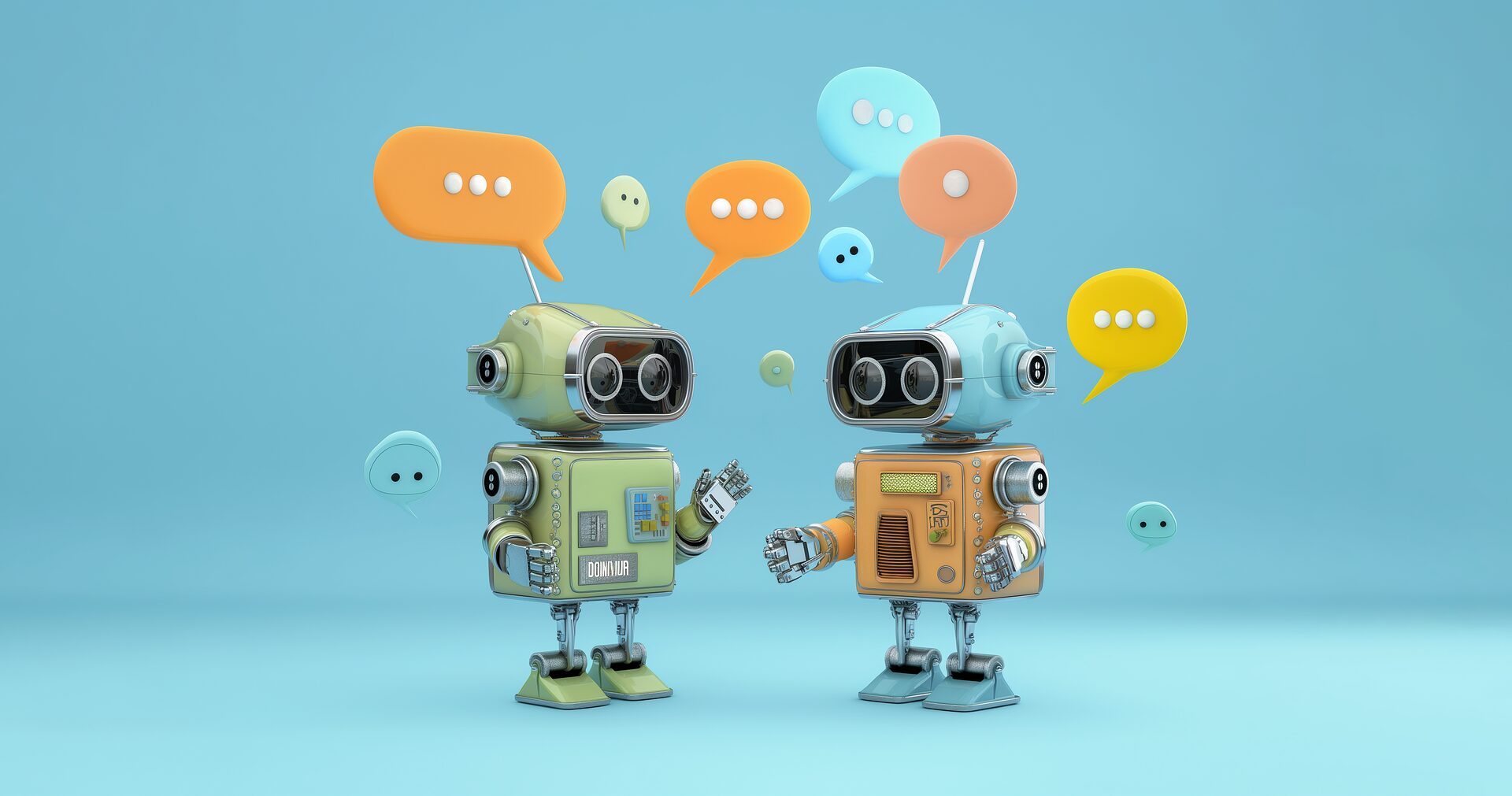


Schreibe einen Kommentar