Metaphern sind das wirkungsvollste rhetorische Stilmittel. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das war auch schon eine Metapher. Ein metaphorisches Sprichwort. Du kennst und nutzt Metaphern schon. Aber vielleicht eher intuitiv. Viele Menschen haben auch die Vorstellung, dass man, sobald man „seriös“ spricht, eher klar und in akademischer Sprache reden sollte.
Dabei ermöglichen gerade Metaphern eine Emotionalisierung, das Anwerfen des Kopfkinos und gehen damit viel tiefer als „nur“ die Zahlen/Daten/Fakten. Und das lässt sich auch wissenschaftlich beweisen. Denn Metaphern sind inzwischen gut erforscht. Fangen wir aber mal am Anfang an. Die Metapher wird schon von Aristoteles erwähnt, in seiner Rhetorik und auch in der Poetik.
Was ist eine Metapher?
Bei Aristoteles heißt es, es sei „die Anwendung eines Namens, der zu etwas anderem gehört“, also eine Übertragung von einem Bereich auf einen anderen. Spätere antike Denker nannten die Metapher einen verkürzten Vergleich. Auch diese Zweck erfüllt sie wunderbar. Wo der Vergleich erst lang ausholt, wirft die Metapher mit einem Wort das Kopfkino der Zuhörenden an. Und das sie funktioniert, ist sehr gut erforscht. Hier einige der spannendsten Ergebnisse:
Wir lernen erst, Metaphern zu verstehen
Eine Studie mit Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren hat gezeigt: Kinder lernen erst mit ca. 12 Jahren komplexere Metaphern zu verstehen. Simple Analogie wie z.B. Tiermetaphern („Du Schwein“, „Gut gebrüllt, Löwe“) verstehen dagegen schon jüngere Kinder. Siehe dazu https://www.metaphorik.de/sites/www.metaphorik.de/files/journal-pdf/vogt-indefrey_metaphorik-27.pdf
Metaphorisches Framing
Über Framing und Priming habe ich bereits einen Artikel verfasst. Da die Metapher als Analogie immer bestimmte Aspekte hervorhebt und andere vernachlässigt, spricht man auch von metaphorischem Framing. Zur Erinnerung: Framing meint, dass die Wahl eines Begriffes unsere Wertung beeinflusst. So hat Hund eine neutrale Konnotation, „Hündchen“ klingt sehr nett und „Köter“ dagegen sehr unschön. Auch die Wahl einer metaphorischen Umschreibung beeinflusst nun die Reaktion. So hat eine Studie (Thibodeau und Boroditsky 2011) ergeben, dass Menschen unterschiedliche Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung für richtig hielten, je nachdem ob man Kriminalität als „Virus“ oder als „wilde Bestie“ bezeichnete. Bei einem Virus fokussierten sich die Teilnehmenden stärker auf Prävention, bei der wilden Bestie mehr auf Sanktionen und hartes Durchgreifen.
Metaphern wirken
Beim Thema Virus auch erwähnenswert: Der Einsatz von Metaphern motivierte mehr Menschen zu einer Grippeschutzimpfung als eine rein sachliche Aufklärung (Scherer et al. 2015). Metaphern wirken also! Das lässt sich sogar im MRT nachweisen. Hier wurde festgestellt, dass Geschmacksmetaphern („das ist ja süß von Dir“ statt „das ist aber nett“) auch die dafür zuständigen Gehirnarreale aktivierten (Citron und Goldberg 2014).
Worauf kommt es nun bei einer guten Metapher an?
- Weniger ist mehr. Mach es nicht komplizierter als nötig und geh nicht mehr ins Detail als nötig. Eine Metapher soll die Fantasie anregen. Erstick die nicht gleich wieder mit zu vielen Details. Das ist auch der Vorteil gegenüber einem Vergleich: Statt lang auszuholen mit „Das ist ja WIE…“ und dann den Vergleich weiter ausführen zu müssen, knallst Du einfach einen Begriff oder einen Satz hin und den Rest machen die Zuhörenden selbst.
- Du musst an bekanntes anknüpfen. Metaphern aus der Quantenphysik kommen eher nicht so gut an. Außer vielleicht bei Fachleuten. Je einfacher die Metapher, desto mehr Menschen kannst Du damit erreichen. Deshalb wird ja auch gerne Fußball bemüht. Bei Wikipedia gibt es sogar eine Übersicht über Sportmetaphern.
- Der „bildhafte Vergleich“ muss auch zutreffen. Sonst läuft die Metapher ins Leere. Oft werden nur Phrasen gedroschen. Und das kann nicht nur nicht zutreffen. Das kann sogar ordentlich ins Auge gehen. Was auch wieder eine Metapher ist übrigens.
- Zu viele Metaphern verderben den Brei. Oder so ähnlich. Wenn Deine Metaphern wirklich wirken, und Du zu viele nacheinander abfeuerst, dann kommt es bei den Zuhörenden zum Overload. Das eine Bild ist gerade erst aufgepoppt, da kommt schon das nächste. So als würde man durchs TV-Programm zappen. Da bleibt nichts hängen. Deshalb gilt auch für die Metapher, wie für jedes rhetorische Stilmittel: Weniger ist mehr.
Metaphernfails
Damit kommen wir zu Den No-Gos. Das Beispiel, das mir immer wieder ins Auge sticht, ist die berühmte „Schnupperstunde.“ Ich weiß, was damit gemeint ist. Aber im Zusammenhang mit Fußpflege oder Kinderballet (alles schon gelesen!) entstehen da bei mir verstörende Bilder. Gerade weil diese Metapher, wie obige Studien zeigen, wirkt. Ansonsten gilt für Metaphern das selbe wie für Witze: Wenn Du sie erklären musst, sind sie nicht gut. Und denke an Deine Zielgruppe. Eine Analogie aus dem American Football ist nett, aber Fußball wäre hierzulande sinnvoller. Auch Analogien aus Videospielen oder popkulturellen Phänomenen sind für älteres Publikum vollkommen unzugänglich.
Fazit
Nutze Metaphern bewusst, aber wähle Deine Metapher weise. Dann wirst Du damit spielend leicht rhetorischen Erfolg haben!






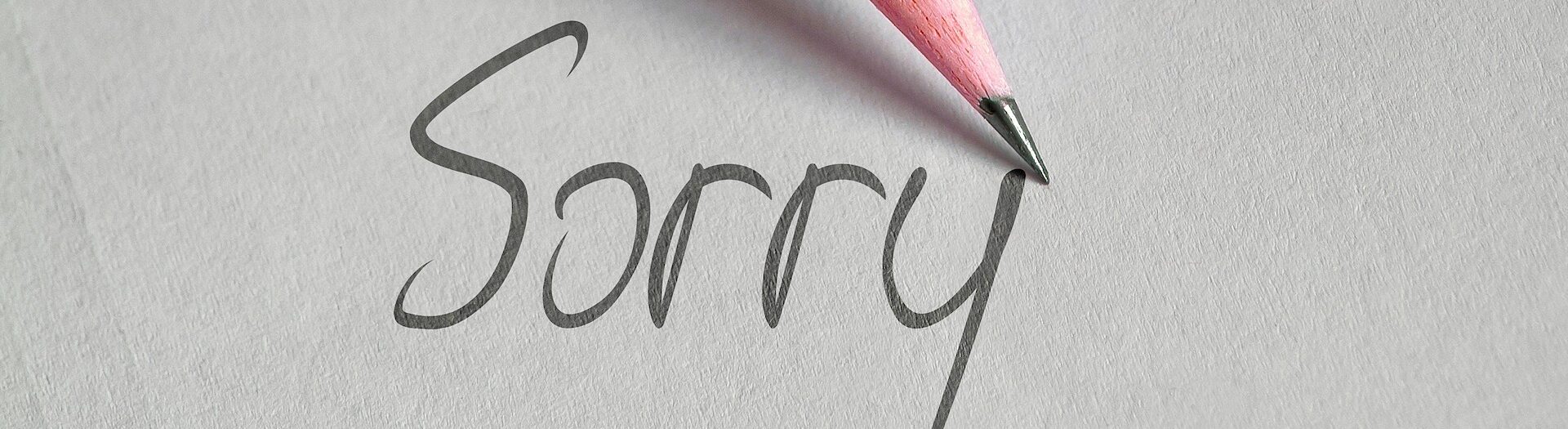
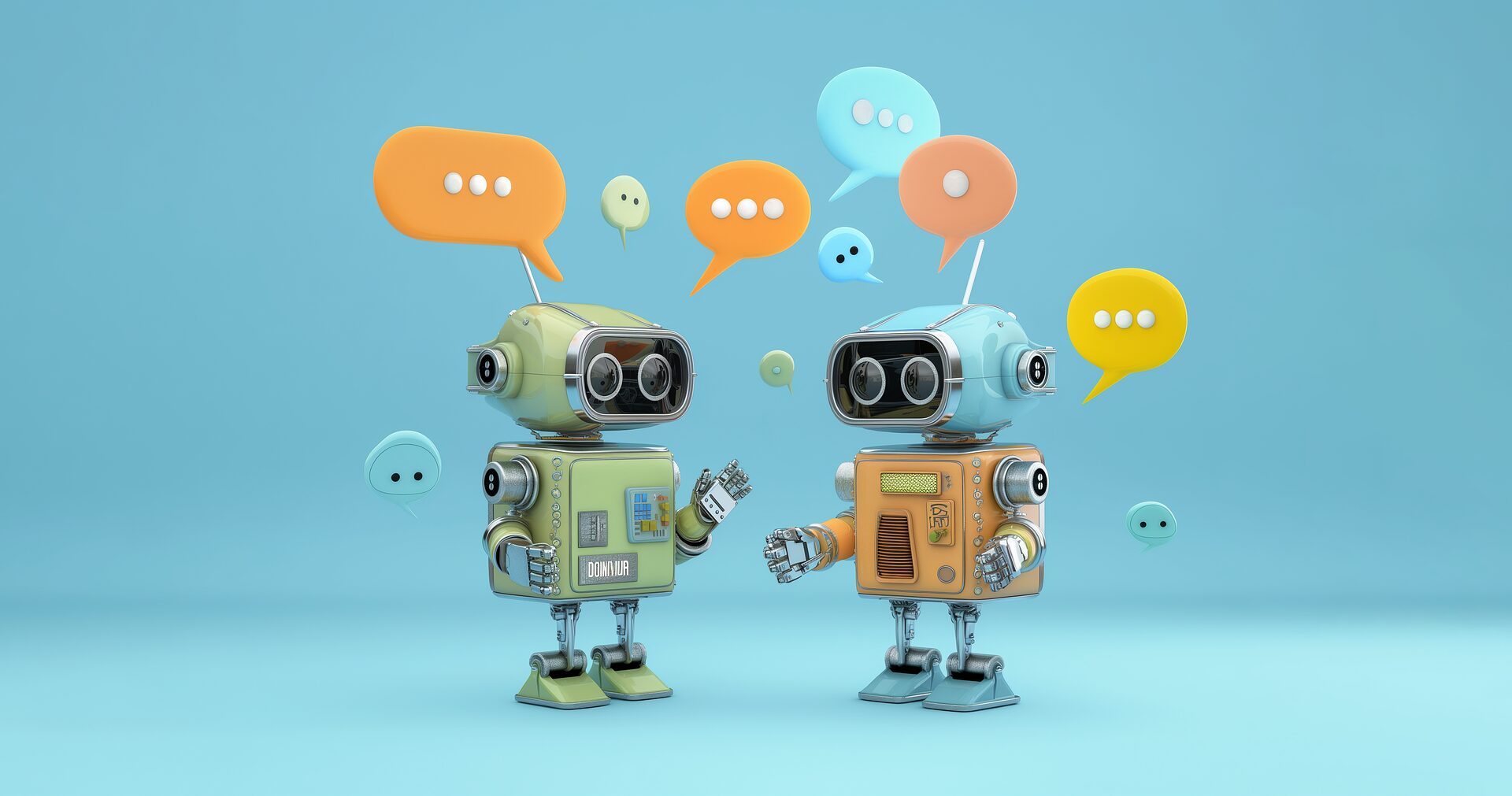


Schreibe einen Kommentar